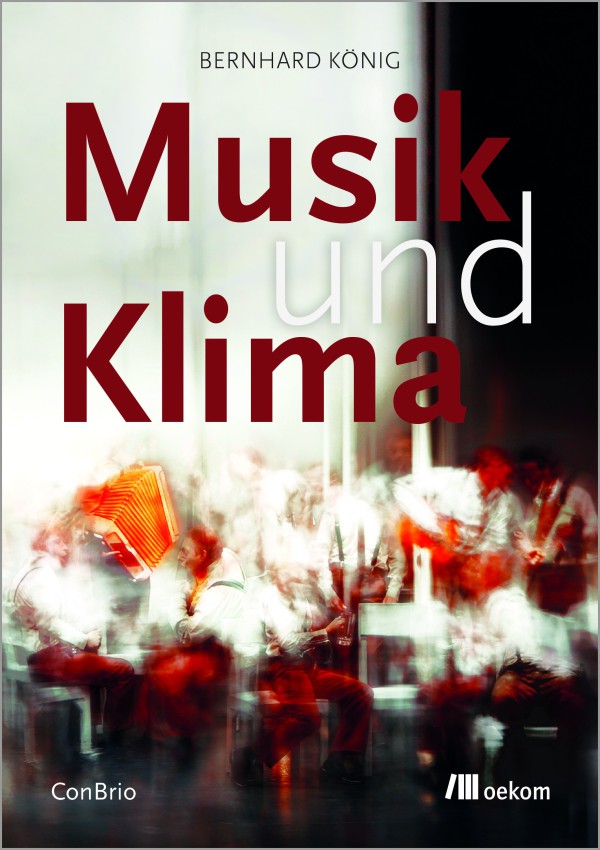„Klimakrise musikalisch wahrnehmen“
RezensionBernhard Königs Buch „Musik und Klima“
Das Klimagewissen: der stille Vorwurf der Avocado, die mahnende Stimme des Steaks und das große Geschrei beim Autofahren – wir alle tragen unser Sündenregister mit den Kilos und Tonnen CO2 mit uns herum, im Bewusstsein, dass wir mit unserer Lebensweise der Erde und ihren Bewohner:innen unweigerlich Schaden zufügen; dass wir die Welt hässlicher machen, selbst im Versuch sie schöner zu machen. Auf diese griffige Formel bringt der Komponist Bernhard König die Fragestellung seines neuen Buchs „Musik und Klima“, erschienen im Juni 2024 bei oekom und con brio. Dem 57-jährigen Komponisten wird der allgegenwärtige Gewissenskonflikt im Angesicht seines jugendlichen Ichs bewusst, das König auf einer Fridays for Future-Demo unter den Protestierenden zu erkennen meint: „Aber es schien mir, als läge ein stiller Vorwurf in seinem Blick.“ (212) Wir alle kennen diesen Vorwurf und er wirft ungemütliche Fragen auch für Musikschaffende auf, deren Verstrickungen in die klimaschädliche Lebensweise unserer Gesellschaft leicht von hehren Idealen und der „Verschönerung“ der Welt überdeckt wird.
Dem Titel entsprechend unternimmt diese Monografie als erste ihrer Art im deutschsprachigen Raum einen Rundumschlag: „Kann Musik die Welt schöner machen?“, „Können Töne etwas ausrichten?“, „Braucht Musik Wachstum?“ und „Können wir uns ändern?“ heißen die vier großen Abschnitte des Buches, welche „die Musik“ in ihrem gegenwärtigen gesellschaftlichen Status angesichts „des Klimas“ im Ganzen hinterfragen. Entsprechend weitschweifig geraten denn auch die Antworten. Sie reichen von grundlegenden Daten und Modellen der klimatischen Entwicklungen über detaillierte Informationen bezüglich des Treibhausgasausschusses verschiedener Musikwirtschaften bis zu den psychologischen Dimensionen der Glaubens- und Gewissensfragen einer Klima(kultur)politik. König verwendet eine Fülle aktueller Literatur aus unterschiedlichen Fachbereichen und bemüht sich dabei um eine anregende und bildreich aufbereitete Sprache. Leider verzettelt er sich dabei aber oft im Für und Wider bestimmter Positionen und Gewissenskonflikte, was die Lektüre gerade für Einsteiger:innen in das Thema zwar informativ, letztlich aber auch langatmig macht.
Es braucht bis Seite 353, dass König schreibt: „Mit der Beschreibung der positiven Gegengewichte habe ich mich bisher zurückgehalten.“ Das hat gute Gründe, schreibt er doch immer wieder selbst, dass es für „die Musik“ „den Zukunftsentwurf“ nicht geben kann. Zwischen den vielen „Aber“, „Doch“ und „Freilich“ schlägt sich aber freilich doch eine Vision durch, was König meint, wenn er fordert: „Die Klimakrise gehört ins Zentrum des musikalischen Wahrnehmens und Gestaltens.“ (104) „Wie [also] könnte eine musikalische Ästhetik aussehen, die sich nicht nur auf das unmittelbare Geschehen zwischen Mensch und Mensch, Klang und Mensch oder Ohr und Kopfhörer bezieht, sondern auch die ökologischen und klimatischen Fernwirkungen des Musikmachens und -konsumierens berücksichtigt?“ Königs Entwurf einer Antwort gräbt tief in die Kultur der Moderne und Postmoderne, indem er eine grundlegende Kritik am aufklärerischen Beherrschungsdrang im Sinne einer Kritik der instrumentellen Vernunft unternimmt.
Ideologisch unterbaut wird dieser Entwurf mit einer zu Beginn jedes Kapitels eingefügten Erzählung der evolutionären Situiertheit von Musik im Prozess der selektiven Ausgestaltung menschlicher Arbeitsteilung. Vom Gesang als magischer Beschwörung vor der Jagd (10), über gemeinsames Singen als Gruppenbildungsprozess (145) entwickelte sich die Musik in der Welt dieses idealtypischen „Menschentieres“ stufenweise bis zur endgültigen Allverfügbarkeit der musikalischen Schönheiten für jeden und jede in unseren Tagen (331). Mit diesem, wahrscheinlich tatsächlich durch besonders anschauungsfreudige Wissenschaft belegbaren Urbild der sozialen Situiertheit von Musik in der menschlichen Phylogenese entwickelt König die Folie, vor der er die Entfremdung der kulturellen Produktion von den ursprünglichen, rituellen und gemeinschaftsstiftenden Formen der Musik behaupten kann.
Insbesondere die klassisch-romantische Musiktradition der Aufklärung habe die holistisch eingebetteten Musiklehren seit Pythagoras untergraben (309) und der Musik in der Autonomieästhetik eine Haltung des andächtigen Gebets aufgeprägt (312), was zu Haltungsschäden in Körper und Geist geführt hätte (315). Der Geist der Aufklärung habe, wie allgemein auf dem Gebiet der Produktion und des Zusammenlebens, auch die Musik mit dem „Mobilisierungs- und Expansionsauftrag“ ausgestattet, der sie bis heute zur Komplizin eines überhitzten Wirtschaftswandels mache (317). Auch konstatiert König der Musik eine eurozentristisch-kolonial geprägte Überheblichkeit, die durch die technische Verfügbar- und Kontrollierbarkeit in den nimmersatten Narzissmus der Gegenwart münde (325). Dieser musikalischen Entfesselung sei eine Kehrtwende entgegenzusetzen, eine Rückbesinnung auf das eigentliche Anwendungsfeld der Musik: „Ein maßvolles, energiearmes, ökologisch verträgliches und dennoch erfülltes Leben im analogen Hier und Jetzt – das ist, so scheint es, zur fernsten und unerreichbarsten aller Gegenwelten geworden.“ (334)
Die musikalische Rückbesinnung auf dieses analoge Hier und Jetzt nennt König – lose an Hartmut Rosa angelehnt – Resonanzästhetik: Musizieren und Komponieren im Altersheim und mit Schulklassen, Chorsingen in der Nachbarschaft und in interreligiösen oder inklusiven Zusammenhängen – diese Vorbilder und Beispiele stammen vor allem aus Königs eigenen Erfahrungen als Komponist und Bildungsarbeiter. Zuletzt wagt er dann auch einen visionären Ausblick: Musik in der Schule als zwanglose Erfahrung der eigenen Ausdruckspotenziale und der eigenen Mündigkeit (419), die Gemeinde als Kern für Musikaktivitäten in Regional- und Laienkultur (422), ein anderes Ideal des Chorsingens, welches die heterogenen Stimm- und Persönlichkeitsmerkmale hervorkehrt und nicht nivelliert (425), Opern und Konzerthäuser, die als Community-Treffpunkte und lokale Musikhäuser neu erfunden werden (428), eine andere Ausbildung, eine klimabezogene Musikforschung und mehr Förderung des Experimentiergeistes in der freien Szene.
All diese Ansätze einer resonanzästhetischen Wende folgen der wachstumskritischen Grundtendenz, die im dritten Kapitel eingeführt wird. „Die Anpassung an diesen schneller werdenden Taktschlag ist keine frei wählbare Option, sondern eine Notwendigkeit – jedenfalls dann, wenn man sich das Musikmachen zum Beruf gemacht hat. Der fatale Nebeneffekt dieses Beschleunigungszwanges: Er ist mit einem steigenden Energie- und Materialaufwand verbunden und zwingt uns Musikliebende, das Gegenteil von dem zu tun, was wir eigentlich tun wollen: Schönheit in die Welt zu bringen.“ (339) In der Rückbesinnung auf den kollektiven Charakter des Musizierens liege deshalb die ultimative Gegenwelt, die einst als das „große Innehalten“ in Geschichte und Mythos eingehen wird. (445) König schließt mit der Aufforderung, „Kunstfreiheit nicht mehr als Freiheit zur grenzenlosen Expansion zu sehen, sondern als Freiheit vom Expansionszwang.“ (443)
Nach der Lektüre bleiben wenig fassbare Antworten. König führt durch das vernünftig Ausgewogene und immer wieder Einschränkende und Abschwächende seiner Gedankengänge tief in das Dickicht der moralischen Fragen heutiger Kulturproduktion hinein. Ebenso schwankend ist das Gefühl, mit dem es mich als Leser zurücklässt: Einerseits ist ein Weckruf für eine Kultur, die in weiten Teilen dem Kult der Vergangenheit und ihrer kolonialen und imperialen Repräsentationsformen dient, heute nötiger denn je. Auch die Forderung nach einer interreligiösen, inklusiven, offenen und hellhörigen Musik sollte in einer Szene, die sich selbst gern als demokratisch und gesellschaftlich relevant bezeichnet, offene Türen einrennen. Es ist bezeichnend, wie wenig divers die Formen der musikalischen Berufstätigkeit auch im Bereich der Neuen Musik immer noch sind.
Andererseits stellt sich beim Lesen immer wieder die Frage: Was hat das mit Musik zu tun? Um welche musikalischen Formen es in den klimaschädlichen Konzerthäusern, auf den Tourneen oder im musikalischen Aktivismus geht, bleibt – bei der Musik verständlicherweise – meist unbestimmt. Der Vermittlungsversuch zwischen Gebrauchsmusik und absoluter Kunst, der historisch kontextualisiert wird, um ihn für unsere Zeit zu entschärfen (185ff), bleibt in dieser Hinsicht oberflächlich. Es wird eben keine „musikalische Ästhetik“ formuliert, sondern lediglich ein fundamentaler Wandel ihrer gesellschaftlichen Produktionsbedingungen. Zweifellos ist das eine nicht vom anderen zu trennen, doch ebenso zweifellos ist es nicht dieselbe Sache.
Wo genau diese Übersetzung von kulturellem Klima und klimaschädlicher Kultur auf die musikalische Ebene stattfindet, ist das eigentliche Rätsel: Ist die Aufführung eines großen Orchesterwerks eines Mannes aus einer kolonialen Luxusgesellschaft in den Räumen einer kolonialen Luxusgesellschaft klimaschädlich? Um es mit der traditionellen Politik der Autonomieästhetik zu sagen: Wo ist der Geist der Ausbeutung im musikalischen Material sedimentiert? Noch vor einer Generation war dies eine bestimmende kompositorische Frage, die aufs Engste mit dem Gebrauch der Musik verbunden war. Für König scheint aus der gesellschaftlichen Totalperspektive die Frage, wie Musik gemacht wird, die Frage, welche Musik gemacht wird, zu dominieren. Nur das Umgekehrte aber würde der Musik wirklich zutrauen, Wandel anstoßen zu können.
Oder ist diese absolut musikalische Haltung wohl am Ende doch so hoffnungslos in die planetaren Gewaltzusammenhänge verstrickt, dass sie als Ganzes abgestoßen werden müsste, um einem ganz neuen Begriff von Musik Platz zu machen? Um welche Musik es sich dabei handeln könnte, bleibt König uns schuldig. An der Kompromisslosigkeit, mit der er die Frage nach einer Musik für eine Gesellschaft im Wandel aufwirft, sollten sich jedoch alle Kulturschaffenden ein Beispiel nehmen – nicht obwohl, sondern gerade weil die ökonomische Basis der bisherigen Musikkultur mächtig bröckelt!